
Netzwerk-sensible
Seniorenarbeit
Gekürzte Fassung eines
Beitrags aus dem
Forum Seniorenarbeit NRW
vom August 2006
Begegnungsräume zu schaffen und neue Kontakte zu stiften gehört zu den
klassischen Zielen in der Seniorenarbeit. Methoden dazu sind aber immer
noch rar. In der Praxis heißt es dazu oft: "Kontakte müssen sich von
selbst ergeben".
Man darf aber nicht davon ausgehen, dass die bloße gemeinsame Anwesenheit
von Menschen in einem Raum bereits Kontakt ermöglicht. Leider werden
Voraussetzungen und Maßnahmen zur Ermöglichung von Kontakt in der Praxis
oft wenig reflektiert. Kein Wunder: Auch in der Fachliteratur zu Geragogik
und Altenarbeit ist zu dieser Fragestellung bislang noch wenig zu finden.
„Netzwerk-sensible Seniorenarbeit“
Der schnelle Wandel in den Formen und Bedingungen „sozialer Integration“
stellt hohe Anforderungen an die Veränderungsfähigkeit der Individuen,
aber auch an die soziale Arbeit.
Eine moderne, gemeinwesenorientierte
Seniorenarbeit sollte bei allen Maßnahmen und Angeboten Möglichkeiten zur
Förderung informeller sozialer Netze in Blick behalten.
Dabei helfen zum Beispiel folgende Fragen:
-
Wovon hängt es
ab, ob im Umfeld der Seniorenarbeit persönliche und freundschaftliche
Kontakte entstehen? Welche Bedingungen tragen dazu bei, dass sich
individuelle soziale Netze erweitern?
-
Welche Methoden
erleichtern es Ehrenamtlichen in Einrichtungen, Teilnehmenden in Kursen
oder Gästen in Seniorentreffs, miteinander ins Gespräch zu kommen und
einander näher kennenzulernen?
-
Und
schließlich: Woran scheitern Kontaktaufnahmen?
„Kennenlernen“ und „Kontakt“
Ein genaueres Nachdenken über Bedingungen sozialer Kontakte lohnt sich auf
jeden Fall. "Ich möchte neue Menschen kennenlernen" ist ein häufig
genanntes Motiv, wenn ältere Menschen gefragt werden, warum sie sich an
Freizeit- und Bildungsangeboten beteiligen oder sich ehrenamtlich
engagieren (Höpflinger 2003).
Kontakt beinhaltet dabei nicht notwendig das Eingehen einer persönlichen
„Bekanntschaft“ oder „Freundschaft“. Kontakt beinhaltet „Präsenz“ und ist
oft nur für den Augenblick. Viele ältere Menschen, die von mir befragt
wurden, betonen den Wert einer freundlichen Atmosphäre in Gruppen und
Kursen, wo persönliche Erfahrungen und Ideen ausgetauscht oder Sorgen und
Nöte angesprochen werden können. Gemeint ist also ein Rahmen, in dem
„Kontakt“ stattfinden kann, der spontanen Austausch ermöglicht und in dem
Erfahrungen auch dann erzählt werden können, wenn sie nicht unmittelbar
mit dem "Thema" zu tun haben.
Leider wird gerade das „Erzählen“ als „besonders intime Forum der
Selbstmitteilung“ in der sozialen Arbeit und Bildungsarbeit oft als
Störung betrachtet (Völzke, 2005). Viele Menschen sind entsprechend
ungeübt im „Erzählen“ und ungeduldiges Zuhören trägt selten zu
interessanterem Erzählen bei. Auch dies spricht dafür, den Prozess der
gegenseitigen Annäherung bei
Veranstaltungen der Seniorenarbeit
nicht dem Zufall zu überlassen.
Es gilt, den Teilnehmenden einen Rahmen zu eröffnen, der das behutsame
Aufeinander-Zugehen unterstützt, eine Vielzahl an Kontaktmöglichkeiten
bietet und damit auch Druck nimmt, zu schnell zu viel von sich
preiszugeben oder Grenzen zu überschreiten.
Bedingungen der Kontaktaufnahme
Freundschaftliche und lose Bindungen zeichnen sich – im Unterschied zu
engen familiären Bindungen - durch ein hohes Maß an Freiwilligkeit aus
(sehr interessant dazu sind die Studien von Sylvia Kade zum
Selbstorganisierten Alter). Die Beteiligten haben die Möglichkeit, ihren
Kontakt in Qualität und Umfang selbst zu steuern. Das Spektrum reicht vom
losen Zusammensein in einer Gruppe bis hin zu gezielten Verabredungen zu
selbstorganisierten Aktivitäten (zur hohen Bedeutung informeller Kontakte
für psychische und körperliche Gesundheit z.B. Badura, 1981 und Hurrelmann,
2003). Kontakt in Veranstaltungen und Gruppen kann persönlich und
freundschaftlich sein, wenn genügend Raum für Teilhabe oder
Selbstorganisation gegeben ist. Dies ist beispielsweise auch dort zu
finden, wo alte Menschen sich 'nur' zum Kaffeetrinken zusammensetzen,
ihre Gesprächsthemen selbständig organisieren und darauf achten, dass
jede(r) zu Wort kommt (immer noch spannend dazu ist die Mikroanalyse zum
Leben in Berliner Seniorenbegegnungsstätten von 1977 bis 1979:
Arbeitsgruppe Interprative Sozialforschung, 1983...).
Bietet eine Veranstaltung dem Einzelnen Gelegenheit, sich in der Gruppe
darzustellen oder von sich zu erzählen, ist ein Kennenlernen in kleinen
Schritten möglich. In dieser eher öffentlichen Atmosphäre ist die
Wahrscheinlichkeit geringer, vorschnell in ungewollte Verbindlichkeiten zu
geraten. Eine „kontaktfreundliche Atmosphäre“ beinhaltet so immer zugleich
die Möglichkeit, Abstand leicht wieder herzustellen, ohne andere zu
verletzen oder selbst verletzt zu werden
In einer Situation, in der ein „lockeres Kennenlernen“ möglich ist – zum
Beispiel am Stehtisch – ist auch ein lockerer Rückzug jederzeit möglich.
Je mehr Aufwand für eine Kontaktaufnahme betrieben werden muss – zum
Beispiel eine Verabredung zum Essen – desto schwerer fällt es, sich
Erwartungen des anderen zu widersetzen und unverbindlich zu bleiben.
Entsteht ein Gefühl von Unfreiheit, wird Kontakt verhindert.
Für sehr einsame Menschen nimmt dies eine besondere Dimension an: Sie
messen neuen Kontakten oft besonders hohe Bedeutung bei und fürchten
entsprechend mehr, selbst zurückgewiesen zu werden oder andere zu
verletzen (Carls, 1994, 1997).
Einfache Methoden
Oft sind es eher einfache Maßnahmen, die
persönliches Kennenlernen erleichtern.
Sie fallen jedem leicht ein, sobald mitbedacht wird, Kontakt möglich zu
machen. Beispiele sind:
-
Räume können
bereits vor Beginn einer Veranstaltung geöffnet werden. Sie sind
freundlich gestaltet und laden die Teilnehmenden dazu ein, schon früher
zu kommen, um mit anderen zu plaudern.
-
Gelegenheiten
werden hergestellt, damit Gemeinsamkeiten entdeckt werden und
Teilnehmende miteinander ins Gespräch kommen können. Zum Beispiel: Die
Teilnehmenden werden mit einer Frage oder einem Impuls in die längere
Pause „entlassen“, der zu Pausendiskussionen anregt. Der Pausenraum ist
inspirierend dekoriert.
-
Mit wechselnden
Kleingruppen wird eine feste Sitzordnung sporadisch durchbrochen.
-
Namensschilder
werden ausgeteilt. Die Namen auf den Schildern sind gut zu lesen. Eine
Namensliste wird erstellt. Namen erleichtern das Ansprechen während der
Veranstaltung und auch die Kontaktaufnahme, wenn es zu einem zufälligen
Zusammentreffen bei anderer Gelegenheit kommt.
-
Es werden
Begegnungen mit anderen Gruppen organisiert (Durchführung gemeinsamer
Veranstaltungen, Besuche in anderen Einrichtungen...).
-
Sehr
wirkungsvoll sind alle Gelegenheiten, die Mitsprache und Mitgestaltung
ermöglichen (Sprecherräte, Planungskreise, Gruppendiskussionen usw.).
Verantwortliche befähigen, Netzwerk-sensibel zu handeln
Für die Förderung individueller sozialer Netze in der Seniorenarbeit
reicht allein der gute Wille der Verantwortlichen nicht aus. Nicht allen
fällt es leicht, Kontakt zwischen anderen Menschen zuzulassen, soziale
Netze als besonders starke Form der Selbstorganisation in ihrem
Arbeitsfeld zu fördern und die damit verbundene Unkontrollierbarkeit von
Prozessen auszuhalten. Netze
knüpfen kann nur, wer von der Bedeutung sozialer Netze überzeugt ist und
deren Wirkung selbst erfährt.
Teams, in denen die Verantwortlichen ihre Arbeit gemeinsam reflektieren
und sich gegenseitig den Rücken stärken, sind ein gutes
Mittel zu einer persönlichen Vernetzung, die alle stärkt.
Und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denen von ihren
Vorgesetzten freie Gestaltungsräume zugestanden werden, fällt es leichter,
anderen Personen Freiräume zu gewähren.
Christian Carls
Langfassung des Beitrags auf den Webseiten des Forum Seniorenarbeit NRW
Literaturhinweise
Arbeitsgruppe
Interpretative Alternsforschung (1983): Alltag in der
Seniorenfreizeitstätte. Soziologische Untersuchungen zur Lebenswelt
älterer Menschen. Berlin.
Badura, Bernhard
(1981): Soziale Unterstützung und chronische Krankheit: Zum Stand
sozialepidemiologischer Forschung. Frankfurt
Carls, Christian
(1994): Altenhilfe als Begegnungsraum: passé? Theorie und Praxis der
Sozialen Arbeit, 2/94, 73- 79
Carls, Christian
(1997): Standortfindung offener / diakonischer Altenarbeit im neuen
Sozialmarkt. Evangelische Impulse, 1/97, 21-24.
Carls, Christian
(2005): Internetcafés –Qualitätskriterien und Rahmenbedingungen. In: DWEKD,
EAFA u. DEVAP (Hg.): Leitfaden: Qualitätsentwicklung in der Offenen
Altenarbeit. Stuttgart/Berlin/Hannover
Eichner, Volker,
Fischer, Veronika und Nell, Karin (Hrsg.) (2003): Netzwerke – ein neuer
Typ bürgerschaftlichen Engagements. Schwalbach/Ts.
Engelmann, Doris: Netzwerkgrenzen weich gestalten.
Online unter
www.kaffee-und-pfefferminz.de (Rubrik "Mehr")
Forum Seniorenarbeit
NRW (Hg.): netzwerk-sensible Seniorenarbeit. Themenschwerpunkt im Juli
2006.
www.forum-seniorenarbeit.de
Höpflinger, François
(2003): Soziale Beziehungen im Alter. Online unter
http://mypage.bluewin.ch/hoepf/fhtop/fhalter1H.htm
Hurrelmann, Klaus
(2003): Gesundheitssoziologie. Weinheim
Kade, Sylvia (2001):
Selbstorganisiertes Alter. Lernen in reflexiven Milieus. Bonn.
Völzke, Reinhard:
Erzählen – Brückenschlag zwischen Leben und Lernen. SOZIALEXTRA, November
2005. Online verfügbar:
www.sozialextra.de/2005-11.htm
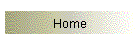
|