|
Christian Carls: Das neue Altersbild
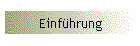 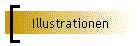 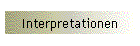   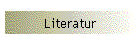 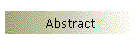
Illustrationen zur Debatte um Altersbilder
 Zum 'negativen Altersbild' in der Gesellschaft allgemein
Zum 'negativen Altersbild' in der Gesellschaft allgemein
 Zum 'negativen Altersbild' in den 'Medien'
Zum 'negativen Altersbild' in den 'Medien'
 Zu den vermuteten Wirkungen des
'negativen Altersbildes' auf die darin Abgebildeten
Zu den vermuteten Wirkungen des
'negativen Altersbildes' auf die darin Abgebildeten
Zum 'negativen Altersbild' in der Gesellschaft allgemein
Ein Mainstream in der Gerontologie agitiert seit über 40
Jahren gegen das 'negative Altersbild', von dem die Gesellschaft
durchzogen sein soll:
 "In our culture with its emphasis on youth and speed,
old people are expected to play a decreasingly active role in
our social and industrial life. These cultural expectations encourage
the formation of misconceptions and stereotypes about old
age." (Tuckmann/Lorge, 1953, 249) "In our culture with its emphasis on youth and speed,
old people are expected to play a decreasingly active role in
our social and industrial life. These cultural expectations encourage
the formation of misconceptions and stereotypes about old
age." (Tuckmann/Lorge, 1953, 249)
 "All diese ... Abweichungen zwischen Erwartungs- und
Erlebniswerten, die noch weit stärker bei den Begründungen
für eine negative Beurteilung der einzelnen Lebensabschnitte
hervortreten, lassen gerade bei der allgemein negativ getönten
Erwartung (bezüglich des höheren Lebensalters, C.C.)
den Einfluß gewisser Stereotypien deutlich werden."
(Lehr, 1964, 224) "All diese ... Abweichungen zwischen Erwartungs- und
Erlebniswerten, die noch weit stärker bei den Begründungen
für eine negative Beurteilung der einzelnen Lebensabschnitte
hervortreten, lassen gerade bei der allgemein negativ getönten
Erwartung (bezüglich des höheren Lebensalters, C.C.)
den Einfluß gewisser Stereotypien deutlich werden."
(Lehr, 1964, 224)
In faszinierender Einförmigkeit wird seither in gerontologischen
Publikationen das 'falsche', das 'negative', 'Altersbild' beklagt
und mit aufklärerischem Impetus ein 'neues', ein 'wissenschaftliches',
'positives Altersbild' dagegengestellt.
Die gängigen Bilder vom 'falschen Altersbild' unterscheiden
sich lediglich in der dramaturgischen Aufbereitung der vermeintlich
vorherrschenden Altersstereotypen. Dabei scheint es den Trend
zu geben, den bisherigen 'Stand der Literatur' durch jeweils noch
buntere und drastischere Darstellungen des 'Altersbildes' zu übertreffen:
 "Denn es gibt - wieder? - eine Anti-Altersideologie.
Sie ist etwas Ähnliches wie die Diskriminierung rassischer
oder religiöser Minderheiten. 'Ageism' (=Altenfeindschaft)
ist vergleichbar mit 'racism' (=Rassenhaß), sagen amerikanische
Forscher." (Becker, 1973, 12; siehe z.B.: Butler,
1969; Palmore, 1972) "Denn es gibt - wieder? - eine Anti-Altersideologie.
Sie ist etwas Ähnliches wie die Diskriminierung rassischer
oder religiöser Minderheiten. 'Ageism' (=Altenfeindschaft)
ist vergleichbar mit 'racism' (=Rassenhaß), sagen amerikanische
Forscher." (Becker, 1973, 12; siehe z.B.: Butler,
1969; Palmore, 1972)
 "So ist das Bild vom alten Menschen in der Öffentlichkeit
bestimmt als ein Bild des Zerfalls, des Abbaus, des Zurückbleibens
hinter der unser menschliches Leben tragenden Norm. Gesehen wird
er als Nörgler, der zum Zusammenleben
schlicht unfähig ist ... Man bescheinigt ihm
Reglosigkeit in seinem Denken ... und Abnahme von Intelligenz
bis hin zur Debilität. Wollte man demgegenüber
eine Liste von positiven Eigenschaften zusammenstellen, so würde
man vergeblich nach allgemein anerkannten und 'modernen' Werten
suchen. Das Bild ist rundweg negativ, und die wenigen positiven
Ausnahmen stützen diese Aussage eher, als daß sie sie
zu relativieren vermöchten." (Bätz/Iber/Middel,
1976, 3) "So ist das Bild vom alten Menschen in der Öffentlichkeit
bestimmt als ein Bild des Zerfalls, des Abbaus, des Zurückbleibens
hinter der unser menschliches Leben tragenden Norm. Gesehen wird
er als Nörgler, der zum Zusammenleben
schlicht unfähig ist ... Man bescheinigt ihm
Reglosigkeit in seinem Denken ... und Abnahme von Intelligenz
bis hin zur Debilität. Wollte man demgegenüber
eine Liste von positiven Eigenschaften zusammenstellen, so würde
man vergeblich nach allgemein anerkannten und 'modernen' Werten
suchen. Das Bild ist rundweg negativ, und die wenigen positiven
Ausnahmen stützen diese Aussage eher, als daß sie sie
zu relativieren vermöchten." (Bätz/Iber/Middel,
1976, 3)
 "Alte Menschen gelten nach allgemeinem Klischee als leistungsschwach,
gebrechlich, krank, pflegebedürftig - auch wenn das für
die eigenen älteren Verwandten bezeichnenderweise nur selten
zutrifft." (Bleuel/Englbrecht/Garms-Homolova, 1976,
21) "Alte Menschen gelten nach allgemeinem Klischee als leistungsschwach,
gebrechlich, krank, pflegebedürftig - auch wenn das für
die eigenen älteren Verwandten bezeichnenderweise nur selten
zutrifft." (Bleuel/Englbrecht/Garms-Homolova, 1976,
21)
 "Minimales Prestige, stark verminderte Leistungsfähigkeit,
Desinteresse an zwischenmenschlichen Beziehungen, physische Häßlichkeit
und geistige Unzurechnungsfähigkeit sind Stereotypen,
mit denen die Öffentlichkeit die Situation der Alten beschreibt."
(Alte Menschen..., 1980, 11) "Minimales Prestige, stark verminderte Leistungsfähigkeit,
Desinteresse an zwischenmenschlichen Beziehungen, physische Häßlichkeit
und geistige Unzurechnungsfähigkeit sind Stereotypen,
mit denen die Öffentlichkeit die Situation der Alten beschreibt."
(Alte Menschen..., 1980, 11)
 "Eine Reihe der erwähnten stereotypen Vorstellungen
seien hier genannt: Alte Menschen sind senil, (...) sehen
alle gleich aus, (...) denken und
handeln alle gleich, (...) können
nichts mehr dazulernen, (...) sind
immer krank, (...) haben keine Freunde
(...) und warten nur noch auf den
Tod. Es muß wohl kaum gesagt werden, daß dies
für die meisten älteren Menschen nicht zutrifft."
(Lowy, 1981, 28 - 30; weitere 'Stereotypen' und 'Mythen'
über das Alter und alte Menschen auf den S. 32-38) "Eine Reihe der erwähnten stereotypen Vorstellungen
seien hier genannt: Alte Menschen sind senil, (...) sehen
alle gleich aus, (...) denken und
handeln alle gleich, (...) können
nichts mehr dazulernen, (...) sind
immer krank, (...) haben keine Freunde
(...) und warten nur noch auf den
Tod. Es muß wohl kaum gesagt werden, daß dies
für die meisten älteren Menschen nicht zutrifft."
(Lowy, 1981, 28 - 30; weitere 'Stereotypen' und 'Mythen'
über das Alter und alte Menschen auf den S. 32-38)
 "Regardless of what model of success in aging is evoked,
old age in America is generally viewed as a total disaster
and, except for death, the ultimate form
of alienation." (Simic, 1982, 45) "Regardless of what model of success in aging is evoked,
old age in America is generally viewed as a total disaster
and, except for death, the ultimate form
of alienation." (Simic, 1982, 45)
 "Das .. erreichte Älterwerden eines Volkes mag dann
Probleme mit sich bringen, (...) wenn man den älteren Menschen
durch leichtfertige Etikettierung generell in die Gruppe der Behinderten
und Pflegebedürftigen einreiht. (...) In Wahrheit
sind nämlich von allen 60- bis 70jährigen nur 0,9% pflegebedürftig
und 0,6% in Heimen." (Lehr, 1987e, 12f.) "Das .. erreichte Älterwerden eines Volkes mag dann
Probleme mit sich bringen, (...) wenn man den älteren Menschen
durch leichtfertige Etikettierung generell in die Gruppe der Behinderten
und Pflegebedürftigen einreiht. (...) In Wahrheit
sind nämlich von allen 60- bis 70jährigen nur 0,9% pflegebedürftig
und 0,6% in Heimen." (Lehr, 1987e, 12f.)
 "Alte Menschen sind nicht in ihrer Gesamtheit einsam,
isoliert, hilflos, krank oder pflegebedürftig.
Eine solch' pathologische Sichtweise muß überwunden
werden." (Haag, 1989, 83) "Alte Menschen sind nicht in ihrer Gesamtheit einsam,
isoliert, hilflos, krank oder pflegebedürftig.
Eine solch' pathologische Sichtweise muß überwunden
werden." (Haag, 1989, 83)
 "Alte sind arteriosklerotisch, senil, vertrottelt,
eigensinnig und starrköpfig. Wie kommt es zu
diesem Vorurteil? Senil wird heute meist abwertend verwendet und
gleichgesetzt mit vergeßlich, geistig abgebaut,
nicht mehr zurechnungsfähig." (Chappuis,
1990, 66)
* Weitere Beschreibungen des 'negativen Altersbildes in der Gesellschaft' z.B. bei: Alte Menschen..., 1980, 11f.; Articus/Braun, 1986, 11ff.; Baltes, 1989, IX; Bartel, 1990, 20ff.; Bechtler, 1993, 13, 17 u. 19; Beer, 1977, 34-41 u. 44ff.; Bergedorfer Gesprächskreis, 1972, 7ff.; Boetticher, 1972, 149f.; Braun, 1992, 27ff.; Buhofer/Waller, 1977, 4-7; Bungard, 1975, 8, 11, 71-76; Butler, 1975, 6-15; Dallinger, 1990, 107; Donicht-Fluck, 1992, 16f.; Ebel, 1987; Ebel, 1989; Eck/Imboden-Henzi, 1972, 8 u. 11; Eichele, 1982 64 u. 68; Eisenbach, 69-72; Erlemeier, 1986, 18; Gores, 1971, 24; Grombach, 1974, 94f.; Gronemeyer/Buff 1992, 21; Hager, 1983, 194 u. 195; Haske, 1988, 116; Hendricks/Hendricks, 1981, 15ff.; Hohmann, 1976, 59f. u. 137; Hooyman, 1988, 536ff.; Innovative Altenarbeit.., 33; Kaiser, 1983, 109ff.; Kaplan, 1979, 25f.; Kardorff/Oppl, 1989, 10; Koch-Straube/Koch/Leisner, 1973, 67 u. 70; Kogon, 1976, 20f. (Redebeitrag U.Lehr); Krohn, 1978, 54; Kruse/Lehr, 1990, 82; Kunz, 1979, 10 u. 15f.; Lehr, 1970, 22ff.; Lehr, 1971, 66; Lehr 1974, 114f.; Lehr, 1976, 63; Lehr, 1978a, 296; Lehr, 1978b, 44f.; Lehr, 1980a, 327ff.; Lehr, 1981a, 85ff.; Lehr, 1984a, 22; Lehr, 1984b, 19; Lehr, 1985b, 35; Lehr, 1986a, 402 u. 405f.; Lehr, 1987c, 5; Lehr, 1987d, 24; Lehr, 1994, 207ff.; Lehr/Oswald, 1991, 6; Lehr/Schmitz-Scherzer, 1970, 183ff. u. 193; Lehr/Schmitz-Scherzer/Quadt, 1979, 72f. u. 75f.; Loddenkemper/Schier, 1981, 20f.; Lowy, 1981, 30ff.; Lübben, 1972, 56f.; McKenzie, 1980, 8-20; Munnichs, 1989, 308; Murphy, 1989, 225; Petzold, 1985, 15f.; Pöhlmann, 1975, 1-12; Pöhlmann, 1977, 15; Reggentin, 1982, 16 u. 18; Rosow, 1967, 31f.; Rupp, 1984, 1f. u. 14; Ruprecht, 1970, 14 u. 19; Schenda, 1972, 141 u. 147ff.; Schmutzler-Müller/Kornwolf, 1991, 244; Schneider, 1974, 66ff.; Schultz, 1992, 24f.; Staiger, 1988, 46; Tews, 1979, 16ff.; Tippelt, 1992, 106; Tokarski, 1986, 32; Voges, 1993, 21ff. u. 39ff.; Witterstätter, 1987, 38-42; Wunderli, 1984, 66ff.; Zimmermann, 1977, 4f..
Die relativ lange Liste ist nicht das Ergebnis verbohrter Recherche. An nur zwei Lesetagen in der Bibliothek einer Fachhochschule für Sozialwesen konnte ich z.B. in den vorhandenen etwa 200 Monographien zur 'Alterssoziologie' 35 Klagen über das 'negative Altersbild' in der Gesellschaft und Plädoyers zu dessen Veränderung (aber keinen Gegenstandpunkt) finden. Sie ließe sich mühelos verlängern. Dies auch, weil die entsprechenden Textpassagen meist leicht zu finden sind: Häufig stehen sie relativ am Anfang, wenn 'die Menschen starben früher früh' ('schon mit 40'), 'die Alten werden immer älter' ('dank moderner Medizin') und 'die Alten werden immer mehr' abgehandelt sind. Die Suche nach solchen Textstellen wird auch dadurch erleichtert, daß diese im Bibliotheksbestand vielfach unterstrichen oder mit Ausrufezeichen und ähnlichen Markierungen der Bedeutsamkeit versehen sind. Allerdings: Vereinzelt lassen sich auch kritische Stellungnahmen zur angeblichen Dominanz eines 'negativen Altersbildes in der Gesellschaft' finden: Brubaker/Powers, 1976; Schonfield, 1982; Lutsky, 1980.(->S.29, ->S.52) skeptische Anmerkungen auch von: Knopf, 1985, 8f; Kondratowitz, 1993, 96; Langehennig, 1983, 5ff; Nittel, 1990, 81 u. 84; Schonfield, 1989; Tews, 1991, 57, 63; Tews, 1992, 5; Thürkow, 1985, 5ff. "Alte sind arteriosklerotisch, senil, vertrottelt,
eigensinnig und starrköpfig. Wie kommt es zu
diesem Vorurteil? Senil wird heute meist abwertend verwendet und
gleichgesetzt mit vergeßlich, geistig abgebaut,
nicht mehr zurechnungsfähig." (Chappuis,
1990, 66)
* Weitere Beschreibungen des 'negativen Altersbildes in der Gesellschaft' z.B. bei: Alte Menschen..., 1980, 11f.; Articus/Braun, 1986, 11ff.; Baltes, 1989, IX; Bartel, 1990, 20ff.; Bechtler, 1993, 13, 17 u. 19; Beer, 1977, 34-41 u. 44ff.; Bergedorfer Gesprächskreis, 1972, 7ff.; Boetticher, 1972, 149f.; Braun, 1992, 27ff.; Buhofer/Waller, 1977, 4-7; Bungard, 1975, 8, 11, 71-76; Butler, 1975, 6-15; Dallinger, 1990, 107; Donicht-Fluck, 1992, 16f.; Ebel, 1987; Ebel, 1989; Eck/Imboden-Henzi, 1972, 8 u. 11; Eichele, 1982 64 u. 68; Eisenbach, 69-72; Erlemeier, 1986, 18; Gores, 1971, 24; Grombach, 1974, 94f.; Gronemeyer/Buff 1992, 21; Hager, 1983, 194 u. 195; Haske, 1988, 116; Hendricks/Hendricks, 1981, 15ff.; Hohmann, 1976, 59f. u. 137; Hooyman, 1988, 536ff.; Innovative Altenarbeit.., 33; Kaiser, 1983, 109ff.; Kaplan, 1979, 25f.; Kardorff/Oppl, 1989, 10; Koch-Straube/Koch/Leisner, 1973, 67 u. 70; Kogon, 1976, 20f. (Redebeitrag U.Lehr); Krohn, 1978, 54; Kruse/Lehr, 1990, 82; Kunz, 1979, 10 u. 15f.; Lehr, 1970, 22ff.; Lehr, 1971, 66; Lehr 1974, 114f.; Lehr, 1976, 63; Lehr, 1978a, 296; Lehr, 1978b, 44f.; Lehr, 1980a, 327ff.; Lehr, 1981a, 85ff.; Lehr, 1984a, 22; Lehr, 1984b, 19; Lehr, 1985b, 35; Lehr, 1986a, 402 u. 405f.; Lehr, 1987c, 5; Lehr, 1987d, 24; Lehr, 1994, 207ff.; Lehr/Oswald, 1991, 6; Lehr/Schmitz-Scherzer, 1970, 183ff. u. 193; Lehr/Schmitz-Scherzer/Quadt, 1979, 72f. u. 75f.; Loddenkemper/Schier, 1981, 20f.; Lowy, 1981, 30ff.; Lübben, 1972, 56f.; McKenzie, 1980, 8-20; Munnichs, 1989, 308; Murphy, 1989, 225; Petzold, 1985, 15f.; Pöhlmann, 1975, 1-12; Pöhlmann, 1977, 15; Reggentin, 1982, 16 u. 18; Rosow, 1967, 31f.; Rupp, 1984, 1f. u. 14; Ruprecht, 1970, 14 u. 19; Schenda, 1972, 141 u. 147ff.; Schmutzler-Müller/Kornwolf, 1991, 244; Schneider, 1974, 66ff.; Schultz, 1992, 24f.; Staiger, 1988, 46; Tews, 1979, 16ff.; Tippelt, 1992, 106; Tokarski, 1986, 32; Voges, 1993, 21ff. u. 39ff.; Witterstätter, 1987, 38-42; Wunderli, 1984, 66ff.; Zimmermann, 1977, 4f..
Die relativ lange Liste ist nicht das Ergebnis verbohrter Recherche. An nur zwei Lesetagen in der Bibliothek einer Fachhochschule für Sozialwesen konnte ich z.B. in den vorhandenen etwa 200 Monographien zur 'Alterssoziologie' 35 Klagen über das 'negative Altersbild' in der Gesellschaft und Plädoyers zu dessen Veränderung (aber keinen Gegenstandpunkt) finden. Sie ließe sich mühelos verlängern. Dies auch, weil die entsprechenden Textpassagen meist leicht zu finden sind: Häufig stehen sie relativ am Anfang, wenn 'die Menschen starben früher früh' ('schon mit 40'), 'die Alten werden immer älter' ('dank moderner Medizin') und 'die Alten werden immer mehr' abgehandelt sind. Die Suche nach solchen Textstellen wird auch dadurch erleichtert, daß diese im Bibliotheksbestand vielfach unterstrichen oder mit Ausrufezeichen und ähnlichen Markierungen der Bedeutsamkeit versehen sind. Allerdings: Vereinzelt lassen sich auch kritische Stellungnahmen zur angeblichen Dominanz eines 'negativen Altersbildes in der Gesellschaft' finden: Brubaker/Powers, 1976; Schonfield, 1982; Lutsky, 1980.(->S.29, ->S.52) skeptische Anmerkungen auch von: Knopf, 1985, 8f; Kondratowitz, 1993, 96; Langehennig, 1983, 5ff; Nittel, 1990, 81 u. 84; Schonfield, 1989; Tews, 1991, 57, 63; Tews, 1992, 5; Thürkow, 1985, 5ff.
Die Beschreibung des 'negativen Altersbildes' erfolgt zumeist
ohne weitere Belege. Manchmal wird pauschal ohne weitere Angaben
auf 'einschlägige Studien' verwiesen:
 "Psychologen und Soziologen haben in den vergangenen drei
Jahrzehnten viel Energie darauf verwendet, das Bild vom alten
Menschen in unserer Gesellschaft zu ermitteln und auf seine Elemente
hin zu untersuchen. Die einschlägigen Studien
kommen dabei im großen und
ganzen zum gleichen Ergebnis: Im
Bild vom alten Menschen herrschen
negative Züge vor. Mit dem Alter werden
gewöhnlich Eigenschaften wie 'inflexibel', 'einsam',
'krank', 'hilfebedürftig'
usw. verbunden. Beim Zustandekommen dieses Bildes spielt die unreflektierte
Übernahme von Gehörtem und Gelesenem ebenso eine Rolle
wie die Verallgemeinerung von Einzelerfahrungen." (Braun,
1992, 27) "Psychologen und Soziologen haben in den vergangenen drei
Jahrzehnten viel Energie darauf verwendet, das Bild vom alten
Menschen in unserer Gesellschaft zu ermitteln und auf seine Elemente
hin zu untersuchen. Die einschlägigen Studien
kommen dabei im großen und
ganzen zum gleichen Ergebnis: Im
Bild vom alten Menschen herrschen
negative Züge vor. Mit dem Alter werden
gewöhnlich Eigenschaften wie 'inflexibel', 'einsam',
'krank', 'hilfebedürftig'
usw. verbunden. Beim Zustandekommen dieses Bildes spielt die unreflektierte
Übernahme von Gehörtem und Gelesenem ebenso eine Rolle
wie die Verallgemeinerung von Einzelerfahrungen." (Braun,
1992, 27)
Ansonsten finden sich häufig Verweise auf die 'Psychologie
des Alterns' von Ursula Lehr (248ff. in den Auflagen von 1972
bis 1987, 284ff. in der 7.Aufl. 1991), wo eine größere
Anzahl von Studien genannt sind, die vorgeblich das negative "Bild
des älteren Menschen in der Gesellschaft" (ebd.) belegen.
Angefügt werden manchmal noch erstaunliche Plausibilisierungen
für die Diagnose eines 'negativen Altersbildes' in der Gesellschaft:
 "Alte Waren taugen nichts mehr, ist die
Devise. Dies führt ganz allgemein zur Abwertung alles Älteren,
nicht mehr Modernen. Im Zuge solcher Haltungen werden auch alte
Menschen abgewertet. Inwieweit es sich positiv auf die Wertschätzung
alter Menschen auswirkt, daß angesichts von Rohstoffkrisen
gebrauchte Gegenstände höher bewertet und wieder verwendet
werden (Recycling), bleibt abzuwarten." (Witterstätter,
1987, 39f.) "Alte Waren taugen nichts mehr, ist die
Devise. Dies führt ganz allgemein zur Abwertung alles Älteren,
nicht mehr Modernen. Im Zuge solcher Haltungen werden auch alte
Menschen abgewertet. Inwieweit es sich positiv auf die Wertschätzung
alter Menschen auswirkt, daß angesichts von Rohstoffkrisen
gebrauchte Gegenstände höher bewertet und wieder verwendet
werden (Recycling), bleibt abzuwarten." (Witterstätter,
1987, 39f.)
 "Alte Kleider, alte Geschichten, alte Leute:
man hat keine rechte Verwendung mehr dafür." (Buhofer/Waller,
1977, 5) "Alte Kleider, alte Geschichten, alte Leute:
man hat keine rechte Verwendung mehr dafür." (Buhofer/Waller,
1977, 5)
Überhaupt sind bildhafte Beschreibungen des 'Altersbildes'
sehr beliebt:
 "Zu den Vorurteilen gehören auch die Annahmen über
einen generell desolaten physischen Zustand alter Menschen. Man
ist geneigt, sie samt und sonders reif für den Misthaufen
der Geschichte zu halten. Jüngere Untersuchungen,
die allerdings noch darauf warten, durch umfassende repräsentative
Studien bestätigt zu werden, lassen mit einem hohen Grad
von Wahrscheinlichkeit erkennen, daß diese Annahmen der
Wirklichkeit gegenüber in keiner Weise standhalten."
(Boetticher, 1972, 149f.) "Zu den Vorurteilen gehören auch die Annahmen über
einen generell desolaten physischen Zustand alter Menschen. Man
ist geneigt, sie samt und sonders reif für den Misthaufen
der Geschichte zu halten. Jüngere Untersuchungen,
die allerdings noch darauf warten, durch umfassende repräsentative
Studien bestätigt zu werden, lassen mit einem hohen Grad
von Wahrscheinlichkeit erkennen, daß diese Annahmen der
Wirklichkeit gegenüber in keiner Weise standhalten."
(Boetticher, 1972, 149f.)
 "Verweist man so im Image der Öffentlichkeit alte
Menschen in den Sarg der Geschichte, so steht
demgegenüber die Statistik..." (Bätz/Iber/Middel,
1976, 3) "Verweist man so im Image der Öffentlichkeit alte
Menschen in den Sarg der Geschichte, so steht
demgegenüber die Statistik..." (Bätz/Iber/Middel,
1976, 3)
 "In unserer heutigen Gesellschaft wird häufig vom
'Alter als Stigma' oder vom alten Menschen als
'Sozialleiche' gesprochen." (Weinbach, 1983, 3; Terminus
z.B. auch bei: Lehr, 1976, 63; Lehr, 1987a, 301; Braun, 1981b,
68) "In unserer heutigen Gesellschaft wird häufig vom
'Alter als Stigma' oder vom alten Menschen als
'Sozialleiche' gesprochen." (Weinbach, 1983, 3; Terminus
z.B. auch bei: Lehr, 1976, 63; Lehr, 1987a, 301; Braun, 1981b,
68)
 "Es ist keine Übertreibung zu behaupten, daß
das an sich wertneutrale Wort 'alt' stark negativ gefärbt
ist. ... Nicht von ungefähr begegnen wir im Zusammenhang
mit dem Alter immer wieder dem Bild vom Schrotthaufen oder
- etwas milder - vom Abstellgleise." (Buhofer/Waller,
1977, 5)
Auch nach 40 Jahren gerontologischer Kritik scheint der aufklärerische
Habitus nichts an Berechtigung eingebüßt zu haben.
Die Klage über das trotz langwährender Aufklärungsbemühungen
'noch immer negative Altersbild' gibt es - unverdrossen im Zeitablauf
und unbeschwert von Zweifeln an der Qualität der Botschaft
- seit über 25 Jahren: "Es ist keine Übertreibung zu behaupten, daß
das an sich wertneutrale Wort 'alt' stark negativ gefärbt
ist. ... Nicht von ungefähr begegnen wir im Zusammenhang
mit dem Alter immer wieder dem Bild vom Schrotthaufen oder
- etwas milder - vom Abstellgleise." (Buhofer/Waller,
1977, 5)
Auch nach 40 Jahren gerontologischer Kritik scheint der aufklärerische
Habitus nichts an Berechtigung eingebüßt zu haben.
Die Klage über das trotz langwährender Aufklärungsbemühungen
'noch immer negative Altersbild' gibt es - unverdrossen im Zeitablauf
und unbeschwert von Zweifeln an der Qualität der Botschaft
- seit über 25 Jahren:
 "Vor allem die in unserer Gesellschaft noch weithin
vorherrschende Meinung, das Altern sei ein ausschließlich
pathologischer Prozeß, sollte durch sachliche Aufklärung
überwunden werden." (Ruprecht, 1970, 14) "Vor allem die in unserer Gesellschaft noch weithin
vorherrschende Meinung, das Altern sei ein ausschließlich
pathologischer Prozeß, sollte durch sachliche Aufklärung
überwunden werden." (Ruprecht, 1970, 14)
 "Das Bild vom älteren Menschen ist auch heute
noch durch Feststellungen von Isolation und Vereinsamung,
von Abhängigkeit und Hilfsbedürftigkeit charakterisiert."
(Ursula Lehr, 1972, 248) "Das Bild vom älteren Menschen ist auch heute
noch durch Feststellungen von Isolation und Vereinsamung,
von Abhängigkeit und Hilfsbedürftigkeit charakterisiert."
(Ursula Lehr, 1972, 248)
 "Freilich galt es zunächst, eine Reihe von stereotypen
Vorstellungen, die in der Öffentlichkeit über alte Menschen
herrschten und zum Teil immer noch
herrschen, wie etwa die der generellen Armut und Hilfsbedürftigkeit
alter Menschen, ihrer Isolierung und Vereinsamung, ihres schlechten
Gesundheitszustandes zu beseitigen.." (Vath, 1973,
11) "Freilich galt es zunächst, eine Reihe von stereotypen
Vorstellungen, die in der Öffentlichkeit über alte Menschen
herrschten und zum Teil immer noch
herrschen, wie etwa die der generellen Armut und Hilfsbedürftigkeit
alter Menschen, ihrer Isolierung und Vereinsamung, ihres schlechten
Gesundheitszustandes zu beseitigen.." (Vath, 1973,
11)
 "Dennoch zeigen die neuesten Untersuchungen vom vergangenen
Jahr, daß dieses durch Defizit, durch Abbau, durch Verlust
von Fähigkeiten gekennzeichnete Altersbild immer noch
in großen Gruppen der Bevölkerung vorherrscht und
sogar ständig verstärkt wird: Sei es durch Schulbücher,
sei es durch eine einseitige Auswahl von Fernsehsendungen, sei
es durch die Werbung..." (Diskussionsbeitrag von Ursula Lehr
in Kogon, 1976, 21) "Dennoch zeigen die neuesten Untersuchungen vom vergangenen
Jahr, daß dieses durch Defizit, durch Abbau, durch Verlust
von Fähigkeiten gekennzeichnete Altersbild immer noch
in großen Gruppen der Bevölkerung vorherrscht und
sogar ständig verstärkt wird: Sei es durch Schulbücher,
sei es durch eine einseitige Auswahl von Fernsehsendungen, sei
es durch die Werbung..." (Diskussionsbeitrag von Ursula Lehr
in Kogon, 1976, 21)
 "Alte Menschen ... gelten ihren jüngeren
Mitmenschen aber immer noch als gebrechlich, passiv,
rigide, wenig umgänglich und schwachköpfig (Lehr 1977a;
Schenda 1970)." (Hastenteufel, 1980a, 530) "Alte Menschen ... gelten ihren jüngeren
Mitmenschen aber immer noch als gebrechlich, passiv,
rigide, wenig umgänglich und schwachköpfig (Lehr 1977a;
Schenda 1970)." (Hastenteufel, 1980a, 530)
 "Viele von uns sind noch immer das Opfer
von stereotypen Vorstellungen über das Alter und die alten
Menschen; und die Alten selbst sind ihrerseits häufig ebenfalls
Opfer dieser Vorstellungen." (Lowy, 1981, 28) "Viele von uns sind noch immer das Opfer
von stereotypen Vorstellungen über das Alter und die alten
Menschen; und die Alten selbst sind ihrerseits häufig ebenfalls
Opfer dieser Vorstellungen." (Lowy, 1981, 28)
 "Vor 5 Jahren haben wir auf das in der Gesellschaft verbreitete
negative Bild vom alten Menschen (S. 248 ff.) hingewiesen... Die
Hoffnung, daß dieses Buch zur Korrektur dieses verzerrt
gezeichneten Bildes beitragen möge (vgl. S. 297), hat sich
bisher zumindest noch nicht eindeutig erkennbar erfüllt.
(...) Belege für das negative
Altersstereotyp auch aus den letzten
Jahren häufen sich." (Lehr, 1987a,
300) "Vor 5 Jahren haben wir auf das in der Gesellschaft verbreitete
negative Bild vom alten Menschen (S. 248 ff.) hingewiesen... Die
Hoffnung, daß dieses Buch zur Korrektur dieses verzerrt
gezeichneten Bildes beitragen möge (vgl. S. 297), hat sich
bisher zumindest noch nicht eindeutig erkennbar erfüllt.
(...) Belege für das negative
Altersstereotyp auch aus den letzten
Jahren häufen sich." (Lehr, 1987a,
300)
 "Immer noch ist in unserer Bevölkerung
ein Altersbild verbreitet, das vom leistungsgeminderten, durch
geistigen und körperlichen Abbau gekennzeichneten, hilfsbedürftigen,
armen, einsamen Menschen ausgeht." (Lehr, 1988d, 11) "Immer noch ist in unserer Bevölkerung
ein Altersbild verbreitet, das vom leistungsgeminderten, durch
geistigen und körperlichen Abbau gekennzeichneten, hilfsbedürftigen,
armen, einsamen Menschen ausgeht." (Lehr, 1988d, 11)
 "'Alten kann man das Telefonbuch vorlesen, sie sind dankbar,
daß sich jemand mit ihnen beschäftigt' - so faßte
kürzlich ein Älterer das vielfach noch
gängige Vorurteil zusammen." (Veelken,
1988a, 60) "'Alten kann man das Telefonbuch vorlesen, sie sind dankbar,
daß sich jemand mit ihnen beschäftigt' - so faßte
kürzlich ein Älterer das vielfach noch
gängige Vorurteil zusammen." (Veelken,
1988a, 60)
 "'Alte Menschen sind lästig, taub, hilfsbedürftig,
laufen am Stock und können auch noch furchtbar nörgeln.'
Dieses Bild vom alten Menschen besteht schon sehr lange und ist
auch heutzutage immer noch springlebendig.
Auch die Medien tragen dazu bei..." (Innovative Altenarbeit...,
1989, 33) "'Alte Menschen sind lästig, taub, hilfsbedürftig,
laufen am Stock und können auch noch furchtbar nörgeln.'
Dieses Bild vom alten Menschen besteht schon sehr lange und ist
auch heutzutage immer noch springlebendig.
Auch die Medien tragen dazu bei..." (Innovative Altenarbeit...,
1989, 33)
 "Alte Menschen wurden als gebrechlich, vergeßlich,
passiv, anfällig, intolerant, konservativ, verbittert und
isoliert beurteilt .. Diese durchweg negativen Attribute waren
für das Altersbild bestimmend (...) Eine große Anzahl
sozialgerontologischer Schriften zeigt (vgl. Ebel 1987), daß
Alter und alte Menschen in unserer Gesellschaft nach wie
vor stigmatisiert werden. (....) M.E. ist das Altersbild
als Stereotyp (griech. starres Muster) nach wie
vor negativ geprägt" (Ebel, 1989, 49f.
u. 55) "Alte Menschen wurden als gebrechlich, vergeßlich,
passiv, anfällig, intolerant, konservativ, verbittert und
isoliert beurteilt .. Diese durchweg negativen Attribute waren
für das Altersbild bestimmend (...) Eine große Anzahl
sozialgerontologischer Schriften zeigt (vgl. Ebel 1987), daß
Alter und alte Menschen in unserer Gesellschaft nach wie
vor stigmatisiert werden. (....) M.E. ist das Altersbild
als Stereotyp (griech. starres Muster) nach wie
vor negativ geprägt" (Ebel, 1989, 49f.
u. 55)
 "Lehr und Thomae (1987) vertreten völlig zu Recht
noch heute die Auffassung, daß das defizitäre
Altersbild in der öffentlichen Meinung noch nicht ausgeräumt
ist." (Schmutzler-Müller/Kornwolf, 1991, 244) "Lehr und Thomae (1987) vertreten völlig zu Recht
noch heute die Auffassung, daß das defizitäre
Altersbild in der öffentlichen Meinung noch nicht ausgeräumt
ist." (Schmutzler-Müller/Kornwolf, 1991, 244)
 "Das vorwiegend negative Sozial- und Selbstbild der
Alten konnte durch die Herausbildung neuer Lebensstile bisher
(noch) nicht zum Kippen gebracht werden." (Rosenmayr,
1994, 464) "Das vorwiegend negative Sozial- und Selbstbild der
Alten konnte durch die Herausbildung neuer Lebensstile bisher
(noch) nicht zum Kippen gebracht werden." (Rosenmayr,
1994, 464)
Und im Lehrbuch der psychologischen und sozialen Alternswissenschaft
von 1990 findet sich eine noch pessimistischere Einschätzung
zur Tendenz des 'gesellschaftlichen Altersbildes':
 "Es gilt mittlerweile als Grundüberzeugung,
daß das Alter bei den meisten Menschen mit sozialer Isolierung
und Einsamkeit einhergeht. Das soziale Netz verkleinert sich und
der Aktionsradius wird immer kürzer, so die vorherrschende
Meinung." (Geuß, 1990, 27) "Es gilt mittlerweile als Grundüberzeugung,
daß das Alter bei den meisten Menschen mit sozialer Isolierung
und Einsamkeit einhergeht. Das soziale Netz verkleinert sich und
der Aktionsradius wird immer kürzer, so die vorherrschende
Meinung." (Geuß, 1990, 27)
 Die Renitenz, mit der 'die Gesellschaft' vermeintlich am 'negativen
Altersbild' festhält, paßt zur Überzeugung der
um 'Aufklärung' bemühten Gerontologen und Wissenschaftsautoren,
daß es sich bei diesem 'Bild' um ein 'Stereotyp'
oder ein Konglomerat von 'Stereotypen' handelt. Die nämlich
sind definitionsgemäß äußerst resistent
gegen Veränderung: Die Renitenz, mit der 'die Gesellschaft' vermeintlich am 'negativen
Altersbild' festhält, paßt zur Überzeugung der
um 'Aufklärung' bemühten Gerontologen und Wissenschaftsautoren,
daß es sich bei diesem 'Bild' um ein 'Stereotyp'
oder ein Konglomerat von 'Stereotypen' handelt. Die nämlich
sind definitionsgemäß äußerst resistent
gegen Veränderung:
 "Das in der Öffentlichkeit verbreitete Altersstereotyp
beschreibt die vermeintlich unabwendbaren Veränderungen,
die das Alter mit sich bringt. Dabei wird individuellen
Unterschieden im Alterungsprozeß kein Raum
gelassen. Die öffentliche Meinung beschreibt den älteren
Menschen als isolierte und vereinsamte, abhängige und hilfsbedürftige
Person. (...) Stereotyp bezeichnet eine festgefügte,
für lange Zeit gleichbleibende
emotional positiv oder negativ gefärbte
Vorstellung von Personen und Gruppen, die nur
begrenzt veränderbar ist. (....) Das
negative Stereotyp hat zur Annahme eines 'Defizitmodells' geführt,
das auch lange Zeit in der Psychologie verbreitet war. ... Obwohl
dieses Modell heute als überholt gilt, ist es sehr
beständig in der öffentlichen Meinung verankert."
(Voges, 1993, 21 u. 24) "Das in der Öffentlichkeit verbreitete Altersstereotyp
beschreibt die vermeintlich unabwendbaren Veränderungen,
die das Alter mit sich bringt. Dabei wird individuellen
Unterschieden im Alterungsprozeß kein Raum
gelassen. Die öffentliche Meinung beschreibt den älteren
Menschen als isolierte und vereinsamte, abhängige und hilfsbedürftige
Person. (...) Stereotyp bezeichnet eine festgefügte,
für lange Zeit gleichbleibende
emotional positiv oder negativ gefärbte
Vorstellung von Personen und Gruppen, die nur
begrenzt veränderbar ist. (....) Das
negative Stereotyp hat zur Annahme eines 'Defizitmodells' geführt,
das auch lange Zeit in der Psychologie verbreitet war. ... Obwohl
dieses Modell heute als überholt gilt, ist es sehr
beständig in der öffentlichen Meinung verankert."
(Voges, 1993, 21 u. 24)
Eine - hinsichtlich der Veränderungsfähigkeit von 'Stereotypen'
- noch deprimierendere Begrifflichkeit wird z.B. von R. Bartel
vertreten:
 "Somit bedeutet 'Altsein', gegen gesellschaftliche Ideale
zu verstoßen. (...) Daraus entstehende gesellschaftlich
bedingte Stereotypen haben stark generalisierenden Charakter und
bilden ein geschlossenes System von irreversiblen
und statischen Bewertungen und Zuschreibungen."
(Bartel, 1990, 21) "Somit bedeutet 'Altsein', gegen gesellschaftliche Ideale
zu verstoßen. (...) Daraus entstehende gesellschaftlich
bedingte Stereotypen haben stark generalisierenden Charakter und
bilden ein geschlossenes System von irreversiblen
und statischen Bewertungen und Zuschreibungen."
(Bartel, 1990, 21)
Ein solches Ausmaß an Unbelehrbarkeit gilt als traurige
Besonderheit der Stigmatisierung alter Menschen:
 "Their stereotypes are also remarkably resistant to change
from exposure to, familiarity and contact with older persons.
The aged, incidentally, are the only minority group for which
this is true. Close contact frequently destroyes social distance
and invidious stereotypes about other devalued groups. But this
does not apply to the aged. Negative images of them are impressively
impervious to exposure and contact." (Rosow, 1967, 32) "Their stereotypes are also remarkably resistant to change
from exposure to, familiarity and contact with older persons.
The aged, incidentally, are the only minority group for which
this is true. Close contact frequently destroyes social distance
and invidious stereotypes about other devalued groups. But this
does not apply to the aged. Negative images of them are impressively
impervious to exposure and contact." (Rosow, 1967, 32)
 "In gewisser Hinsicht haben es die Alten mit ihrem Stereotyp
sogar noch schwerer als normale Minoritäten. In aller Regel
gilt nämlich, daß durch Interaktionen mit Minoritäten
bestehende Vorurteile ihnen gegenüber abgebaut werden. ...
Nur bei den Vorurteilen den Alten gegenüber ist das nicht
so. Drake (1957) konnte zeigen, daß weder Häufigkeit
noch Intensität des Kontaktes zwischen Alten und Jungen das
Stereotyp beeinflußt, daß die Jungen von den Alten
haben. Es kommt nicht zu besseren Urteilen - ganz gleich, wie
lange man mit den Alten zusammenwohnt und wie häufig der
Kontakt ist. Das Stereotyp der Alten und des Alters scheint
resistent gegen jede Veränderung. " (Tews, 1979,
18f.) "In gewisser Hinsicht haben es die Alten mit ihrem Stereotyp
sogar noch schwerer als normale Minoritäten. In aller Regel
gilt nämlich, daß durch Interaktionen mit Minoritäten
bestehende Vorurteile ihnen gegenüber abgebaut werden. ...
Nur bei den Vorurteilen den Alten gegenüber ist das nicht
so. Drake (1957) konnte zeigen, daß weder Häufigkeit
noch Intensität des Kontaktes zwischen Alten und Jungen das
Stereotyp beeinflußt, daß die Jungen von den Alten
haben. Es kommt nicht zu besseren Urteilen - ganz gleich, wie
lange man mit den Alten zusammenwohnt und wie häufig der
Kontakt ist. Das Stereotyp der Alten und des Alters scheint
resistent gegen jede Veränderung. " (Tews, 1979,
18f.)
Das 'negative Altersbild' wird aber nicht nur allgemein 'in der
Gesellschaft' vermutet. Als Träger und (Mit-)Verursacher
gelten auch eine Reihe ausgewählter 'Institutionen unserer
Gesellschaft':
 "Genau betrachtet gibt es ja so etwas wie ein 'System'
von Meinungen, Erlebnissen, schiefem Faktenwissen und negativen
Vorurteilen, das immer wieder von Institutionen unserer Gesellschaft
wie der Schule, der Wissenschaft, den Massenmedien
und auch von Organisationen wie Altenheimen
und Altenpflegeheimen verstärkt, sich als höchst
resistent erweist gegen alle Versuche, daran Korrekturen anzubringen."
(Blaschke/Debast, 1982, 224f.) "Genau betrachtet gibt es ja so etwas wie ein 'System'
von Meinungen, Erlebnissen, schiefem Faktenwissen und negativen
Vorurteilen, das immer wieder von Institutionen unserer Gesellschaft
wie der Schule, der Wissenschaft, den Massenmedien
und auch von Organisationen wie Altenheimen
und Altenpflegeheimen verstärkt, sich als höchst
resistent erweist gegen alle Versuche, daran Korrekturen anzubringen."
(Blaschke/Debast, 1982, 224f.)
(...)
Zum 'negativen Altersbild' in den 'Medien'
Als Träger und Mitverursacher des 'negativen Altersbildes'
gelten u.a. auch 'die Medien'.
Beschuldigt werden i.d.R. zunächst 'die Medien' allgemein,
 ("Nach weitverbreiteten Annahmen bedeutet Älterwerden
einen Verlust seelisch-geistiger Fähigkeiten, einen Abbau
psychischer Funktionen. Nach diesen Vorstellungen, die durch Massenmedien
... immer wieder genährt werden ... geht Älterwerden
mit zunehmender Gebrechlichkeit, Isolation und sogar mit zunehmender
Unzurechnungsfähigkeit einher." (Lehr, 1973, 19) ("Nach weitverbreiteten Annahmen bedeutet Älterwerden
einen Verlust seelisch-geistiger Fähigkeiten, einen Abbau
psychischer Funktionen. Nach diesen Vorstellungen, die durch Massenmedien
... immer wieder genährt werden ... geht Älterwerden
mit zunehmender Gebrechlichkeit, Isolation und sogar mit zunehmender
Unzurechnungsfähigkeit einher." (Lehr, 1973, 19)
 "Vermittler von Alternskonzepten sind neben den Interaktionspartnern
des täglichen Lebens die Massenmedien. Sie pflegen
das gängige Stereotyp vom passiven, kränklichen, wenig
attraktiven und ziemlich überflüssigen alten Menschen
..". (Hastenteufel, 1980a, 530)) "Vermittler von Alternskonzepten sind neben den Interaktionspartnern
des täglichen Lebens die Massenmedien. Sie pflegen
das gängige Stereotyp vom passiven, kränklichen, wenig
attraktiven und ziemlich überflüssigen alten Menschen
..". (Hastenteufel, 1980a, 530))
eine bisweilen orakelhafte Auswahl unterschiedlicher Medien,
 ("Die Mehrheit der älteren Menschen hat es gar nicht
nötig, als bemitleidenswert dargestellt zu werden. So hinfällig,
wie dieser alte Mensch in Illustrierten, Fernsehen
und Zeitungen geschildert wird, ist er gar nicht. (...)
Als Störfaktor ersten Ranges muß daher das 'Image',
welches der ältere Mensch in unserer Gesellschaft hat, angesehen
werden. Bedauernswerterweise erfährt dieses Image durch verschiedene
Publikationsorgane - z.T. sicher unbeabsichtigt - eine zunehmende
Verstärkung." (Lehr/Schmitz-Scherzer, 1970, 183) ("Die Mehrheit der älteren Menschen hat es gar nicht
nötig, als bemitleidenswert dargestellt zu werden. So hinfällig,
wie dieser alte Mensch in Illustrierten, Fernsehen
und Zeitungen geschildert wird, ist er gar nicht. (...)
Als Störfaktor ersten Ranges muß daher das 'Image',
welches der ältere Mensch in unserer Gesellschaft hat, angesehen
werden. Bedauernswerterweise erfährt dieses Image durch verschiedene
Publikationsorgane - z.T. sicher unbeabsichtigt - eine zunehmende
Verstärkung." (Lehr/Schmitz-Scherzer, 1970, 183)
 "Analysen von Lesebüchern, aber auch von
Illustrierten und Fernsehsendungen ... lassen leicht
erkennen, worauf dieses 'Bild des alten Menschen' als hilfsbedürftigen,
an das Mitleid appellierenden bedauernswerten Menschen zurückzuführen
ist." (Lehr, 1970, 24)) "Analysen von Lesebüchern, aber auch von
Illustrierten und Fernsehsendungen ... lassen leicht
erkennen, worauf dieses 'Bild des alten Menschen' als hilfsbedürftigen,
an das Mitleid appellierenden bedauernswerten Menschen zurückzuführen
ist." (Lehr, 1970, 24))
 "Lesen wir die Presse oder sehen wir
fern oder schauen wir uns die Werbung an, so fällt
eines auf: der ältere Mensch wird negativ gesehen und abgewertet."
(Schmitz-Scherzer, 1973: nach Pöhlmann, 1975, 7)) "Lesen wir die Presse oder sehen wir
fern oder schauen wir uns die Werbung an, so fällt
eines auf: der ältere Mensch wird negativ gesehen und abgewertet."
(Schmitz-Scherzer, 1973: nach Pöhlmann, 1975, 7))
die gelegentlich fortgesetzt wird mit einer Klage über einzelne
Publikationskanäle, beispielsweise 'die Lese-' oder 'Schulbücher',
 ("Das Altersstereotyp läßt sich schon bei
Kindern nachweisen... Es ist in Schullesebüchern ebenso
wie in den Mitteilungen der Massenmedien enthalten."
(Hohmeier, 1978, 15) ("Das Altersstereotyp läßt sich schon bei
Kindern nachweisen... Es ist in Schullesebüchern ebenso
wie in den Mitteilungen der Massenmedien enthalten."
(Hohmeier, 1978, 15)
 "Sodann ist es dringend notwendig, das Bild der a priori
armen, hilfsbedürftigen und törichten Alten endlich
aus unseren Schulbüchern und Medien zu verbannen."
(Hager, 1983, 194)) "Sodann ist es dringend notwendig, das Bild der a priori
armen, hilfsbedürftigen und törichten Alten endlich
aus unseren Schulbüchern und Medien zu verbannen."
(Hager, 1983, 194))
oder 'die Werbung':
 "In der Werbung kennzeichnen Rigidität, Unkenntnis
über neuere Entwicklungen, Festhalten am Gewohnten das Bild
der älteren Frau. Der ältere Mann wird als Zahnprothesenträger,
der auf vitalisierende Medikamente angewiesen ist, charakterisiert;
bestenfalls als stiller Genießer von Alkohol, Kaffee und
Schokolade." (Lehr, 1976, 63) "In der Werbung kennzeichnen Rigidität, Unkenntnis
über neuere Entwicklungen, Festhalten am Gewohnten das Bild
der älteren Frau. Der ältere Mann wird als Zahnprothesenträger,
der auf vitalisierende Medikamente angewiesen ist, charakterisiert;
bestenfalls als stiller Genießer von Alkohol, Kaffee und
Schokolade." (Lehr, 1976, 63)
 "Werbung und Fernsehen stellen zum
großen Teil ein Bild des Alters dar, das dem Defizit-Modell
entspricht. Altern bedeutet Rückzug aus der Lebensfülle,
und der alte Mensch ist ein gebrechlicher, leidender Greis oder
eine passive, hilflose Greisin." (Müller, 1988, 85) "Werbung und Fernsehen stellen zum
großen Teil ein Bild des Alters dar, das dem Defizit-Modell
entspricht. Altern bedeutet Rückzug aus der Lebensfülle,
und der alte Mensch ist ein gebrechlicher, leidender Greis oder
eine passive, hilflose Greisin." (Müller, 1988, 85)
Das negative Altenbild in den Medien soll laut Ursula Lehr bis
heute - jedenfalls bis in die späteren 80er Jahre - fortbestehen:
 "Während man vor 10-15 Jahren erste positivere Anzeichen
eines günstiger werdenden Altersbildes (in den Medien und
der Gesellschaft, C.C.) wahrnehmen konnte, müssen wir jetzt
leider eine 'Wende' zurück, eine Wende zu
einem negativen Altersbild, zu einer zunehmenden
Problematisierung des Alters konstatieren..." (Lehr, 1986b,
nach Dierl, 1989, 8) "Während man vor 10-15 Jahren erste positivere Anzeichen
eines günstiger werdenden Altersbildes (in den Medien und
der Gesellschaft, C.C.) wahrnehmen konnte, müssen wir jetzt
leider eine 'Wende' zurück, eine Wende zu
einem negativen Altersbild, zu einer zunehmenden
Problematisierung des Alters konstatieren..." (Lehr, 1986b,
nach Dierl, 1989, 8)
Zu den vermuteten Wirkungen des
'negativen Altersbildes' auf die darin Abgebildeten
Vermutlich würden Gerontologen, Geragogen und Wissenschaftsautoren,
die sich im Streit für das 'neue Altersbild' engagieren,
darum nicht so viel Aufhebens machen, wäre da nicht die Überzeugung
von den unmittelbar schädlichen Wirkungen des 'falschen Altersbildes'.
Zentral ist dabei die Vorstellung, daß das 'Fremdbild' oder,
meist in synonymer Verwendung, das 'Heterostereotyp' in das 'Selbstbild',
also 'Autostereotyp', übernommen wird:
 "Psychologischen Gesetzen zufolge bestimmt das Fremdbild
(d.h., das 'Bild', das andere Menschen von einem haben) das Selbstbild..."
(Lehr, 1973, 19) "Psychologischen Gesetzen zufolge bestimmt das Fremdbild
(d.h., das 'Bild', das andere Menschen von einem haben) das Selbstbild..."
(Lehr, 1973, 19)
 "Wenn sie (Nicht-Alte, C.C.) z.B. glauben, daß
ältere Menschen vor allem hilfsbedürftig und passiv
sind, kann das dazu führen, daß ältere
Menschen das selbst glauben und
ein entsprechendes Selbstbild entwickeln."
(Eisenbach, 1977, 70) "Wenn sie (Nicht-Alte, C.C.) z.B. glauben, daß
ältere Menschen vor allem hilfsbedürftig und passiv
sind, kann das dazu führen, daß ältere
Menschen das selbst glauben und
ein entsprechendes Selbstbild entwickeln."
(Eisenbach, 1977, 70)
 "So, wie andere sie sehen, sehen die alten Menschen am
Ende sich selbst." (Witterstätter, 1987, 41) "So, wie andere sie sehen, sehen die alten Menschen am
Ende sich selbst." (Witterstätter, 1987, 41)
Wenn 'alte' Menschen mal doch 'so' sind, wie ihnen im 'falschen
Altersbild' unterstellt, dann, so wird angenommen, vor allem deshalb,
weil sie dieses Bild internalisiert haben. Über den
Internalisierungsprozeß und gefügig-analoges Verhalten
soll das 'negative Altersbild' mithin schuld daran sein, daß
'alte' Menschen hilfebedürftiger und
einsamer sind, weniger Sport treiben und seltener Geschlechtsverkehr
haben, als sie 'eigentlich' wären und hätten:*
 "Many behavioral and personality characteristics, it
is now recognized, are shaped by the expectations of others, and
members of any age group tend to conform to the stereotype into
which society casts them. ... Thus it may occur that old
people yield passively to the
self-fulfilling prophecies their social
image procjects such as conservatism, preoocupation
with health, loss of memory, inability to learn, and withdrawal
from social activities." (Eklund, 1969, 339) "Many behavioral and personality characteristics, it
is now recognized, are shaped by the expectations of others, and
members of any age group tend to conform to the stereotype into
which society casts them. ... Thus it may occur that old
people yield passively to the
self-fulfilling prophecies their social
image procjects such as conservatism, preoocupation
with health, loss of memory, inability to learn, and withdrawal
from social activities." (Eklund, 1969, 339)
 "Hier haben wir es vielleicht mit einem der gewichtigsten
Probleme im Zusammenhang mit dem Alter überhaupt zu tun;
es ist gewissermaßen ein sozialpsychologisches
Diktum, wonach Menschen sich gerade
so verhalten, wie man es von
ihnen erwartet." (Lowy, 1981, 28) "Hier haben wir es vielleicht mit einem der gewichtigsten
Probleme im Zusammenhang mit dem Alter überhaupt zu tun;
es ist gewissermaßen ein sozialpsychologisches
Diktum, wonach Menschen sich gerade
so verhalten, wie man es von
ihnen erwartet." (Lowy, 1981, 28)
 "Das Selbstbild und die Realitätsorientierung des
älteren Menschen werden von solchen Stereotypisierungen affiziert
und bestimmen dann sein reales Verhalten." (Lehr,
1987a, 253) "Das Selbstbild und die Realitätsorientierung des
älteren Menschen werden von solchen Stereotypisierungen affiziert
und bestimmen dann sein reales Verhalten." (Lehr,
1987a, 253)
 "The self-fulfilling prophecy einer
Pflegebedürftigkeit im Alter: Bei uns
neigt man dazu, ältere Menschen - zumindest aber die über
70-, 80jährigen - von vorneherein als Behinderte, Hilfs-
und Pflegebedürftige zu sehen. Muß nicht angesichts
dieser vorherrschenden Meinung jeder Älterwerdende dann Angst
haben, zu einem Pflegefall zu werden, so daß sich aufgrund
der negativen Erwartungshaltung erst eine Pflegebedürftigkeit
einstellt?" (Lehr, 1987b, 882) "The self-fulfilling prophecy einer
Pflegebedürftigkeit im Alter: Bei uns
neigt man dazu, ältere Menschen - zumindest aber die über
70-, 80jährigen - von vorneherein als Behinderte, Hilfs-
und Pflegebedürftige zu sehen. Muß nicht angesichts
dieser vorherrschenden Meinung jeder Älterwerdende dann Angst
haben, zu einem Pflegefall zu werden, so daß sich aufgrund
der negativen Erwartungshaltung erst eine Pflegebedürftigkeit
einstellt?" (Lehr, 1987b, 882)
 "Die Vorstellung, daß ältere Menschen fast
immer der Hilfe bedürfen, ist eine eindeutige Verzerrung
der viel differenzierteren Realität. (...) Dieses negative
Etikett wird von den Älteren internalisiert. Sie fangen an,
sich selbst als inkompetent zu sehen, was letzten
Endes zu einem Verlust der noch vorhandenen
Fähigkeiten führt. Die Folge davon
ist, daß sich ältere Menschen
generell als unfähig ansehen..."
(Munnichs, 1989, 309) "Die Vorstellung, daß ältere Menschen fast
immer der Hilfe bedürfen, ist eine eindeutige Verzerrung
der viel differenzierteren Realität. (...) Dieses negative
Etikett wird von den Älteren internalisiert. Sie fangen an,
sich selbst als inkompetent zu sehen, was letzten
Endes zu einem Verlust der noch vorhandenen
Fähigkeiten führt. Die Folge davon
ist, daß sich ältere Menschen
generell als unfähig ansehen..."
(Munnichs, 1989, 309)
Auch beim 'Internalisierungstheorem' gibt es die Tendenz,
die an sich simple Idee mit immer aufwendigeren Erläuterungen
und dramatischeren, scheinbar aus dem Leben gegriffenen Beispielen
zu versehen:
 "Der 'Feind von außen'. Es
sind dies die gesellschaftlichen Kräfte, die ... ihm sagen,
du bist alt, krank, leistungsunfähig. .... Der 'Feind
von innen'. Das sind die Selbstbilder, die der alte
Mensch von sich hat, daß er kränklich sei, zu nichts
mehr tauge, wohlverdiente Ruhe genießen solle, daß
er zurückgezogen, schwarz angezogen, möglichst lautlos
leben solle. .... Die negativen Altersselbstbilder
der alten Menschen sind ein
mächtiger Feind, der ein guter
Verbündeter für den 'Feind
von außen' ist. Beide verstärken
sich wechselseitig. " (Petzold, 1985, 15f.) "Der 'Feind von außen'. Es
sind dies die gesellschaftlichen Kräfte, die ... ihm sagen,
du bist alt, krank, leistungsunfähig. .... Der 'Feind
von innen'. Das sind die Selbstbilder, die der alte
Mensch von sich hat, daß er kränklich sei, zu nichts
mehr tauge, wohlverdiente Ruhe genießen solle, daß
er zurückgezogen, schwarz angezogen, möglichst lautlos
leben solle. .... Die negativen Altersselbstbilder
der alten Menschen sind ein
mächtiger Feind, der ein guter
Verbündeter für den 'Feind
von außen' ist. Beide verstärken
sich wechselseitig. " (Petzold, 1985, 15f.)
 "Vorurteile ... erzeugen häufig 'self-fulfilling-prophecies'.
Dazu ein Beispiel eines älteren Arbeitnehmers:
Ein älterer Arbeitnehmer wird von seinen jüngeren Kollegen
als geistig unbeweglich, als Eigenbrötler, als unkooperativ,
als nur noch mangelhaft leistungsfähig eingeschätzt.
Diese Einschätzung wird beim Jüngeren allmählich
zur Überzeugung. Warum? Am Arbeitsplatz zeigt er zwar nach
wie vor die von ihm verlangten Leistungen, ja er versucht sogar,
diese noch zu steigern. Das bringt ihm zwar einige Belobigungen
vom Vorgesetzten ein, aber gleichzeitig die Kollegen noch mehr
gegen ihn auf. Sein Fleiß wird von ihnen als unsoziales
Strebertum verurteilt, durch das sie nur Nachteile hätten.
Die Atmosphäre am Arbeitsplatz wird immer mehr vergiftet.
Unter diesen Bedingungen und dem (selbstauferlegten) Zwang, es
den anderen zumindest im Leistungsbereich zeigen zu müssen,
passieren dem älteren Mitarbeiter garantiert einige Fehler.
Es sind zwar keine gravierenden 'Böcke', aber von seinen
Kollegen werden sie als solche behandelt. Nun bestätigt sich
also die Einschätzung, der Leistungsabfall des älteren
Mitarbeiters sei eklatant, und überhaupt sei mit ihm nicht
mehr viel los. Der Ältere verfällt
in Resignation und Passivität."
(Staudacher, 1986, 15f.) "Vorurteile ... erzeugen häufig 'self-fulfilling-prophecies'.
Dazu ein Beispiel eines älteren Arbeitnehmers:
Ein älterer Arbeitnehmer wird von seinen jüngeren Kollegen
als geistig unbeweglich, als Eigenbrötler, als unkooperativ,
als nur noch mangelhaft leistungsfähig eingeschätzt.
Diese Einschätzung wird beim Jüngeren allmählich
zur Überzeugung. Warum? Am Arbeitsplatz zeigt er zwar nach
wie vor die von ihm verlangten Leistungen, ja er versucht sogar,
diese noch zu steigern. Das bringt ihm zwar einige Belobigungen
vom Vorgesetzten ein, aber gleichzeitig die Kollegen noch mehr
gegen ihn auf. Sein Fleiß wird von ihnen als unsoziales
Strebertum verurteilt, durch das sie nur Nachteile hätten.
Die Atmosphäre am Arbeitsplatz wird immer mehr vergiftet.
Unter diesen Bedingungen und dem (selbstauferlegten) Zwang, es
den anderen zumindest im Leistungsbereich zeigen zu müssen,
passieren dem älteren Mitarbeiter garantiert einige Fehler.
Es sind zwar keine gravierenden 'Böcke', aber von seinen
Kollegen werden sie als solche behandelt. Nun bestätigt sich
also die Einschätzung, der Leistungsabfall des älteren
Mitarbeiters sei eklatant, und überhaupt sei mit ihm nicht
mehr viel los. Der Ältere verfällt
in Resignation und Passivität."
(Staudacher, 1986, 15f.)
Hinzu kommt die Annahme, daß auch das 'falsche Fremdbild'
nicht nur 'da' ist, sondern ebenfalls im ganz alltäglichen
Verhalten wirksam wird:
 "Im Zusammenhnag mit der Einstellung gegenüber alten
Menschen möchte ich folgendes feststellen: Die Meinungen,
Ansichten und Verhaltensweisen der Menschen sind oft ein Spiegel
abgedroschener und landläufiger Äußerungen und
Denkweisen. Wir sind nur allzu bereit, verbreitete Annahmen
und völlig ungerechtfertigte gedankliche Muster ganz oder
zum Teil zu übernehmen und uns dann entsprechend
zu verhalten. Das gilt in besonderem
Maße in Bezug auf die
Alten. Alte Menschen werden häufig als homogene Gruppe
klassifiziert, als amorphe, in sich nicht differenzierte, unpersönliche
Wesen..." (Lowy, 1981, 28) "Im Zusammenhnag mit der Einstellung gegenüber alten
Menschen möchte ich folgendes feststellen: Die Meinungen,
Ansichten und Verhaltensweisen der Menschen sind oft ein Spiegel
abgedroschener und landläufiger Äußerungen und
Denkweisen. Wir sind nur allzu bereit, verbreitete Annahmen
und völlig ungerechtfertigte gedankliche Muster ganz oder
zum Teil zu übernehmen und uns dann entsprechend
zu verhalten. Das gilt in besonderem
Maße in Bezug auf die
Alten. Alte Menschen werden häufig als homogene Gruppe
klassifiziert, als amorphe, in sich nicht differenzierte, unpersönliche
Wesen..." (Lowy, 1981, 28)
- und daß die 'Älteren', die sich der Internalisierung
des 'Fremdbildes' verschließen, durch offensiven Druck zum
'so sein' genötigt werden:
 "Bei Widersprüchen zwischen Stereotyp und dem Verhalten
des Beurteilungsobjektes wird man durch Sanktionen die Anpassung
des Objektes an das allgemeine Pauschalurteil erstreben. Dadurch
ist man der Notwendigkeit enthoben, sein festgefügtes Weltbild
zu ändern, das ja durch vielfältige Beziehungen mit
den einzelnen Stereotypen liiert ist." (Schneider, 1974,
70f.) "Bei Widersprüchen zwischen Stereotyp und dem Verhalten
des Beurteilungsobjektes wird man durch Sanktionen die Anpassung
des Objektes an das allgemeine Pauschalurteil erstreben. Dadurch
ist man der Notwendigkeit enthoben, sein festgefügtes Weltbild
zu ändern, das ja durch vielfältige Beziehungen mit
den einzelnen Stereotypen liiert ist." (Schneider, 1974,
70f.)
Hier spätestens stellt sich die Frage, wer überhaupt
im 'negativen Altersbild' abgebildet sein soll und wer sich davon
abgebildet sieht ( - um es ggf. internalisieren zu können).
Für Protagonisten des 'neuen Altersbildes' scheint klar zu
sein, daß die Zuordnung nach dem Alter an
Jahren vonstatten geht:
 "Als einziger Störfaktor, der allein vom Lebensalter
abzuhängen scheint, erweist sich das 'Image' des älteren
Menschen in unserer Gesellschaft!" (Lehr/Schmitz-Scherzer,
1970, 193) "Als einziger Störfaktor, der allein vom Lebensalter
abzuhängen scheint, erweist sich das 'Image' des älteren
Menschen in unserer Gesellschaft!" (Lehr/Schmitz-Scherzer,
1970, 193)
Uneins ist man sich lediglich hinsichtlich der zum 'Alt-sein'
notwendigen Anzahl an Lebensjahren; i.d.R. gilt als 'alt', wer
60 oder 65 Jahre oder älter ist:
 "Denn im Alter werden wir alle eine Alters-Klasse von
12 Millionen Bürgern in der Bundesrepublik (gemeint sind
also die über 60jährigen, C.C.) (...) Sie werden
in die Isolation geschickt, die Erwartungsnormen haben dazu geführt.
Und sie akzeptieren es, glauben selbst an das Altersdefizit, das
von der Wissenschaft längst als Zwecklüge entlarvt wurde."
(Bleuel/ Englbrecht/Garms-Homolova, 1976, 21) "Denn im Alter werden wir alle eine Alters-Klasse von
12 Millionen Bürgern in der Bundesrepublik (gemeint sind
also die über 60jährigen, C.C.) (...) Sie werden
in die Isolation geschickt, die Erwartungsnormen haben dazu geführt.
Und sie akzeptieren es, glauben selbst an das Altersdefizit, das
von der Wissenschaft längst als Zwecklüge entlarvt wurde."
(Bleuel/ Englbrecht/Garms-Homolova, 1976, 21)
 "Unsere Gesellschaft neigt dazu, 'den Alten' - und das
sind heute spätestens die über 60jährigen
- eine jede Kompetenz abzusprechen und sie .. zu einer Problemgruppe
abzustempeln. Alte Menschen sind - und das heute noch mehr als
vor 25 Jahren - eine gemachte Problemgruppe.." (Lehr, 1987g,
22) "Unsere Gesellschaft neigt dazu, 'den Alten' - und das
sind heute spätestens die über 60jährigen
- eine jede Kompetenz abzusprechen und sie .. zu einer Problemgruppe
abzustempeln. Alte Menschen sind - und das heute noch mehr als
vor 25 Jahren - eine gemachte Problemgruppe.." (Lehr, 1987g,
22)
Hier und dort finden sich aber auch andere Zahlen:
 "Der Alterungsprozeß im psychischen und physichen
Bereich wird sich verlangsamen, wenn man Leute über 40
nicht mehr als 'Outgroup' ansieht." (Hohmann, 1976, 137) "Der Alterungsprozeß im psychischen und physichen
Bereich wird sich verlangsamen, wenn man Leute über 40
nicht mehr als 'Outgroup' ansieht." (Hohmann, 1976, 137)
 "Über das Leben der Frau im höheren Lebensalter
werden in der Bevölkerung besonders ungünstige Erwartungen
geäußert. Schon ab dem 40. Lebensjahr erwartet
man für die Frau verstärkt gesundheitliche Probleme,
finanzielle Schwierigkeiten und Einsamkeit (Lehr 1961)."
(Kaiser, 1983, 110) "Über das Leben der Frau im höheren Lebensalter
werden in der Bevölkerung besonders ungünstige Erwartungen
geäußert. Schon ab dem 40. Lebensjahr erwartet
man für die Frau verstärkt gesundheitliche Probleme,
finanzielle Schwierigkeiten und Einsamkeit (Lehr 1961)."
(Kaiser, 1983, 110)
 "Das Stereotyp des hinter dem Ofen sitzenden, wirklichkeitsfremden,
tatterigen Greises scheint nach Ansicht bestimmter Bevölkerungsgruppen
bereits für den Menschen vom 50. Lebensjahr an zuzutreffen."
(Lehr, 1970, 24) "Das Stereotyp des hinter dem Ofen sitzenden, wirklichkeitsfremden,
tatterigen Greises scheint nach Ansicht bestimmter Bevölkerungsgruppen
bereits für den Menschen vom 50. Lebensjahr an zuzutreffen."
(Lehr, 1970, 24)
 "... verstehen wir in dieser Arbeit unter Betagten Menschen
ab 62..." (Buhofer/Waller, 1977, 4) "... verstehen wir in dieser Arbeit unter Betagten Menschen
ab 62..." (Buhofer/Waller, 1977, 4)
C. Zur (Selbst-)Beauftragung der Gerontologie,
den Kampf gegen das 'falsche Altersbild' aufzunehmen
Aus alledem schließen die Kritiker des 'negativen Altersbildes'
ihren Auftrag, die Gesellschaft, die 'Alten', die Akteure in der
Altenarbeit, die Jugendlichen, die Kindergarten- und Schulkinder
und alle anderen über das 'wissenschaftliche Wissen' um das
'Alter' aufzuklären:
 "Vor allem die in unserer Gesellschaft noch weithin vorherrschende
Meinung, das Altern sei ein ausschließlich pathologischer
Prozeß, sollte durch sachliche Aufklärung
überwunden werden. Nicht zu Unrecht hat Thomae immer wieder
darauf hingewiesen, daß das Defizit-Modell in der Alternsforschung
reformiert werden müsse." (Ruprecht, 1970, 14) "Vor allem die in unserer Gesellschaft noch weithin vorherrschende
Meinung, das Altern sei ein ausschließlich pathologischer
Prozeß, sollte durch sachliche Aufklärung
überwunden werden. Nicht zu Unrecht hat Thomae immer wieder
darauf hingewiesen, daß das Defizit-Modell in der Alternsforschung
reformiert werden müsse." (Ruprecht, 1970, 14)
 "Um das Fremdbild der älteren Generation zu verbessern,
müßten wir uns im Grunde an die mittlere und jüngere
Generation wenden, hier informieren, Vorurteile abbauen..."
(Buhofer/ Waller, 1977, 6) "Um das Fremdbild der älteren Generation zu verbessern,
müßten wir uns im Grunde an die mittlere und jüngere
Generation wenden, hier informieren, Vorurteile abbauen..."
(Buhofer/ Waller, 1977, 6)
 "Hier gilt es, einmal, durch Aufklärungskampagnen
und sachliche Orientierung das negative, am Defizit-Modell orientierte
Fremdbild des alten Menschen zu korrigieren. Da das
Fremdbild das Selbstbild beeinflußt, dürfte es mit
der Zeit - vielleicht allerdings erst bei der älteren Generation
von morgen oder übermorgen - zu einem positiveren Gesamterleben
im Alter kommen." (Lehr/Schmitz-Scherzer/Quadt, 1979, 57) "Hier gilt es, einmal, durch Aufklärungskampagnen
und sachliche Orientierung das negative, am Defizit-Modell orientierte
Fremdbild des alten Menschen zu korrigieren. Da das
Fremdbild das Selbstbild beeinflußt, dürfte es mit
der Zeit - vielleicht allerdings erst bei der älteren Generation
von morgen oder übermorgen - zu einem positiveren Gesamterleben
im Alter kommen." (Lehr/Schmitz-Scherzer/Quadt, 1979, 57)
 "Die Verbesserung der Einstellungen
gegenüber anderen Gesellschafts- oder Altersgruppen muß
systematisch ins Bewußtsein möglichst vieler Menschen
gebracht werden." (Hager, 1983, 194) "Die Verbesserung der Einstellungen
gegenüber anderen Gesellschafts- oder Altersgruppen muß
systematisch ins Bewußtsein möglichst vieler Menschen
gebracht werden." (Hager, 1983, 194)
 "Wir wählten Themen aus, die zu praxisbezogener
Betrachtung anregen. Sie könnten die Richtung angeben, in
der zukünftig weitergearbeitet werden müßte: Korrektur
des vorurteilsvollen Bildes vom alten
Menschen in der Öffentlichkeit, Aufwertung
des Selbstbildes und des Selbstwertgefühls
alter Menschen und damit Abkoppelung von einem die Lebenschancen
bescheidenden Prozeß der Sich-selbst-erfüllenden-Prophezeiung..."
(Kaiser, 1983, 128) "Wir wählten Themen aus, die zu praxisbezogener
Betrachtung anregen. Sie könnten die Richtung angeben, in
der zukünftig weitergearbeitet werden müßte: Korrektur
des vorurteilsvollen Bildes vom alten
Menschen in der Öffentlichkeit, Aufwertung
des Selbstbildes und des Selbstwertgefühls
alter Menschen und damit Abkoppelung von einem die Lebenschancen
bescheidenden Prozeß der Sich-selbst-erfüllenden-Prophezeiung..."
(Kaiser, 1983, 128)
 "Um hier Änderungen zu erreichen, werden wir vor
allem selbst die Ärmel hochkrempeln müssen. Vorrangig
ist uns selbst die Aufgabe gestellt, zu einem Abbau des
negativen Bildes der älteren
Generation in der Gesellschaft beizutragen." (Haag,
1989, 83) "Um hier Änderungen zu erreichen, werden wir vor
allem selbst die Ärmel hochkrempeln müssen. Vorrangig
ist uns selbst die Aufgabe gestellt, zu einem Abbau des
negativen Bildes der älteren
Generation in der Gesellschaft beizutragen." (Haag,
1989, 83)
 "Eine Politik mit dem Ziel, die Lebensqualität im
Alter zu erhöhen, müßte bereits im Kindergarten
anfangen. Schon im Vorschulalter gilt es einmal, das Bild
vom alten Menschen als einem kompetenten,
selbständigen, selbstverantwortlichen Bürger zurechtzurücken..."
(Lehr, 1991b, 183; die logische Syntax ist etwas irreführend,
gefordert wird natürlich die Korrektur des Bildes vom inkompetenten
alten Menschen.) "Eine Politik mit dem Ziel, die Lebensqualität im
Alter zu erhöhen, müßte bereits im Kindergarten
anfangen. Schon im Vorschulalter gilt es einmal, das Bild
vom alten Menschen als einem kompetenten,
selbständigen, selbstverantwortlichen Bürger zurechtzurücken..."
(Lehr, 1991b, 183; die logische Syntax ist etwas irreführend,
gefordert wird natürlich die Korrektur des Bildes vom inkompetenten
alten Menschen.)
 "Insbesondere erhöht eine sachorientierte
Beeinflussung der öffentlichen Meinung auch die Wahrscheinlichkeit,
daß sich Menschen, die in die Altersphase eintreten und
vielleicht auch solche, die sich schon in dieser Phase befinden,
aus den Fesseln eines undifferenzierten negativen Bildes vom Alter
freimachen." (Braun, 1992, 28f.) "Insbesondere erhöht eine sachorientierte
Beeinflussung der öffentlichen Meinung auch die Wahrscheinlichkeit,
daß sich Menschen, die in die Altersphase eintreten und
vielleicht auch solche, die sich schon in dieser Phase befinden,
aus den Fesseln eines undifferenzierten negativen Bildes vom Alter
freimachen." (Braun, 1992, 28f.)
Mit zuweilen inquisitorischem Impetus wird gegen Autoren zu Felde
gezogen, die der 'Pflicht' zur Förderung des 'neuen Altersbildes'
nicht nachzukommen scheinen:
 "Wissenschaftliche Forschung hat u.a. die Funktion, falsche
Meinungen über Sachverhalte unseres Lebensalltages aufzudecken
und zu korrigieren. Dem fühlen auch wir uns mit dem
vorliegenden Buch verpflichtet. Nicht jeder Beitrag im Umfeld
gerontologischer Forschung aber ist geeignet, zur Korrektur des
verzerrten Bildes vom alten Menschen beizutragen." (Kaiser,
1983, 113) "Wissenschaftliche Forschung hat u.a. die Funktion, falsche
Meinungen über Sachverhalte unseres Lebensalltages aufzudecken
und zu korrigieren. Dem fühlen auch wir uns mit dem
vorliegenden Buch verpflichtet. Nicht jeder Beitrag im Umfeld
gerontologischer Forschung aber ist geeignet, zur Korrektur des
verzerrten Bildes vom alten Menschen beizutragen." (Kaiser,
1983, 113)
H. J. Kaiser bekräftigt dies an anderer Stelle:
 "Ein realitätsangemessenes Altersbild in der Bevölkerung
zu erreichen, ist das Ziel jeden Bemühens um Aufklärung."
(Kaiser, 1989, 202) "Ein realitätsangemessenes Altersbild in der Bevölkerung
zu erreichen, ist das Ziel jeden Bemühens um Aufklärung."
(Kaiser, 1989, 202)
Dort immerhin folgt die verunsicherte Frage: "Was
aber soll als 'Realität' des
Alterns und Altseins vermittelt werden?"
(...)
Literaturverzeichnis
zurück
Weitere Linkhinweise:
Homepage:
www.ccarls.de
Arbeitskreis Geragogik
Aktuell:
Netzwerkarbeit: Netzwerk-sensible Seniorenarbeit
-
Prävention, Gesundheitsförderung & moderne
Seniorenarbeit -
Paradoxe des Altersbegriffs, Grenzen der klassischen
Altersbildforschung und Perspektiven für eine neue Debatte um Altersbilder
|